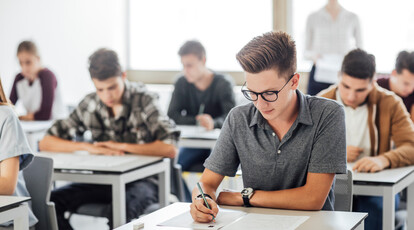32. Sachverständigentag der Sächsischen Industrie- und Handelskammern
25. September 2025Der Sachverständigentag in Sachsen hat Tradition. Peggy Wöhlermann, die in der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig für Sachverständigenwesen zuständig ist, kennt die Ursprünge. Die Idee, alle sächsischen Sachverständigen zusammenzubringen, entstand durch den Wunsch, eine Plattform für den Austausch der Sachverständigen untereinander zu schaffen und aktuelle Themen für die Sachverständigen in Vorträgen aufzubereiten. Nach und nach hat sich die Veranstaltung als wichtiges Treffen für fachlichen Input und Netzwerkmöglichkeiten im landesweiten Sachverständigenwesen etabliert.
Die Vorträge spiegelten die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen wider, denen sich Sachverständige in ihrem Alltag stellen, zeigten aber auch viele Potenziale und Möglichkeiten für eine Erleichterung der Arbeit auf.
Drohnen in der Sachverständigentätigkeit
Martin Haubold, Dipl.-Ing. (FH) für Fahrzeugtechnik, von der IHK Halle-Dessau öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter, hielt einen Vortrag über den Einsatz von Drohnen in der Sachverständigentätigkeit. In seiner Arbeit für die ForSeMa GmbH verwendet er seit 2015 Drohnen in unterschiedlichen Ausführungen und Größen für die Aufnahmen von Bildmaterial.
Neben einer allgemeinen Einführung zur Gesetzgebung rund um unterschiedliche Klassen von Drohnen, Fernpilotenzeugnisse, Versicherungen und Datenschutz gab Haubold eine Fülle von praktischen Beispielen der Drohneneinsätze. So konnten bei der Einrichtung einer Geschwindigkeitsmessung auf der Autobahn dank Drohnenaufnahmen exakte und maßgetreue Abbildungen der Straße erstellt werden. Bei Schornsteinen werden Drohnen auch regelmäßig eingesetzt. Geschützt von einer Art Käfig können sie mühelos in Schornsteine abtauchen und Aufnahmen machen. Durch die Ausstattung mit zusätzlichen, spezialisierten Kameras und Sensoren ergeben sich noch mehr Möglichkeiten: Wärme(verlust) und Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden können mit hoher Genauigkeit festgestellt und dokumentiert werden.
Die wichtigsten Vorteile von Drohneneinsätzen sieht Haubold in der Ersparnis von Kosten und Zeit bei Aufnahmen und der Erleichterung von Visualisierungen in Gutachten, die ohne Drohne mühsam als technische Zeichnung oder Diagramm erstellt werden müssten.
Doch die Praxis ist manchmal auch schwergängig: Beim Kaffee im Foyer berichtet ein Unternehmer aus Leipzig über sein Vorhaben, eine Drohne für die Prüfung einer einsturzgefährdeten Fassade einzusetzen. „Wir haben bei der Stadt einen Antrag gestellt, aber da wurde uns mitgeteilt, dass die Bearbeitung ca. ein Dreivierteljahr dauern würde, mit unklarem Ausgang.“ Für die potenziell gefährliche Fassade kam diese Wartezeit nicht infrage. So habe er dann doch auf die klassische Methode zurückgegriffen und sein Mitarbeiter sei hochgeklettert, um den historischen Putz zu begutachten. Die lange Bearbeitungszeit läge daran, dass sich die Fassade auf der Hubschrauberstrecke des Uniklinikums befände. Am Ende störte es ihn aber nicht so sehr: „Ich glaube, es ist sowieso besser, es mit eigenen Augen sehen und anfassen zu können.“
Videoverhandlungen und elektronische Kommunikation mit den Gerichten in Sachsen
Kristin Krah, Richterin am Sächsischen Oberlandesgericht in Dresden, griff in ihrem Vortrag Videoverhandlungen und weitere digitale Kommunikation zwischen Gerichten und Sachverständigen auf. Die Digitalisierung der Gerichte im Freistaat schreitet voran, aber dennoch brauche es etwas Geduld: „Jahrhundertealte Strukturen und Abläufe werden aufgebrochen.“ In einer Präsentation erklärte sie, an welchen Herausforderungen es an manchen Stellen noch hakt, aber auch, welche Möglichkeiten vielen gegebenenfalls gar nicht bewusst sind.
So steht es Sachverständigen immer frei, die Zuschaltung per Video zu Gerichtsverhandlungen zu beantragen. Die zuständige Richterin oder der zuständige Richter trifft dazu eine Entscheidung; Es besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme aus der Ferne. Krah wirbt aber an der Stelle auch für Verständnis: „Gerade Vergleichsverhandlungen möchte man als Richter eher persönlich durchführen. Ein Bildschirm mit kleinen Kacheln in einem leeren Saal ist da ungünstig.“
Ihren Vortrag verstehe sie in erster Linie als Gesprächsangebot für die Sachverständigen. Viele der Anwesenden nahmen dies dankend an und brachten ihre eigenen Erfahrungen und Probleme rund um die digitale Interaktion mit Gerichten ein. Eine Sachverständige fragte, warum ihr vom Gericht Dateien per CD-ROM zugesendet werden, die sie mit ihrem handelsüblichen Laptop gar nicht auslesen kann. Krah konnte ihren Frust nachvollziehen, aber wenn eine sichere Datenübertragung auf einem sicheren Übermittlungsweg nicht gewährleistet werden kann, stehen nur wenige Alternativen zur Verfügung. „Die CD ist kein böser Wille, die ist Gesetz.“
Das Onlinezugangsgesetz, das die deutsche Verwaltung digitaler und benutzerfreundlicher gestalten soll, greift auch für die Gerichte. Im Zuge dessen schweben dem Justizwesen unterschiedliche Lösungen vor, von Ausweismöglichkeiten über das vorhandene ELSTER bis hin zu einer umfassenden Onlineplattform, in der geeignete Verfahren komplett digital abgewickelt werden können. Es wird jetzt an einem Konzept für eine datenschutzkonforme Umsetzung dieser Lösungen gearbeitet. Bis dahin bleiben einige Wege nur analog eröffnet.
KI im Sachverständigenbüro
Der größten Herausforderung unter den Referierenden stellte sich Jacob Armbruster, Geschäftsführer der BLAID GmbH. Ein lokaler Stromausfall in der Leipziger Innenstadt sorgte dafür, dass er seinen Vortrag zu Künstlicher Intelligenz zunächst ohne Laptop, Beamer und Licht begann. Als der Strom nach einer Zeit wieder floss, führte Armbruster das Publikum ins Gespräch mit ChatGPT. Er zeigte, wie man mit den richtigen Prompts die KI zum persönlichen Assistenten im Büro machen kann.
Er ließ Gutachten vorbereiten, schreiben und verbessern. Dabei zeigte er aber auch die Schwächen der generierten Texte. Am Ende trage man immer noch selbst die Verantwortung über die gelieferte Arbeit: „Ich kann mich von meinem Assistenten unterstützen lassen, aber es bleibt natürlich mein Gutachten.“ Das Urheberrecht, aber auch die ausgedehnten Möglichkeiten der KI rund um persönliche Daten warfen auch ethische Fragen beim Publikum auf. Armbruster gestand ein: „Nur weil es mit KI gehen würde, heißt es nicht, dass wir das auch machen wollen.“
Die größten Vorteile von Anwendungen wie ChatGPT und Microsofts Copilot sieht Armbruster in der Recherchearbeit. Während Google zu einem Suchbegriff recht unsortiert Webseitenadressen ausgibt, können die KI-Programme auch mit weiteren Nachfragen umgehen und die Suchergebnisse konkretisieren, solange Nutzende exakt genug beschreiben, was sie brauchen. Dazu gibt es auch die Möglichkeit, KI einen sogenannten Deep Search („Tiefsuche“) machen zu lassen, wobei über längere Zeit (zumindest länger als bei einfachen Fragen) nach Inhalten und Zusammenhängen recherchiert und ein längerer Aufsatz zum Thema generiert wird. Schnelles Durcharbeiten von großen Textmengen mit KI spart kostbare Zeit und erleichtert die Arbeit.
Ob Drohne, Videokonferenz oder KI – die Zukunft der Gutachtenarbeit ist digital. Doch beim Kaffee im Foyer war man sich einig: Am Ende zählt immer noch der prüfende Blick des Sachverständigen. Wir bedanken uns bei Martin Haubold, Kristin Krah und Jacob Armbruster für die interessanten Vorträge und lebendigen Diskussionen mit dem Publikum sowie bei Yves Brettschneider für die Moderation des Tages.
Der 33. Sachverständigentag findet 2026 in Dresden statt – erneut mit spannenden Einblicken und der Möglichkeit zum fachlichen Austausch.
Mehr erfahren zum Sachverständigenwesen im Leipziger IHK-Bezirk?
Lesen Sie auch:
- Sachverständige und Gutachten – Informationen der IHK zu Leipzig
- Ein Agieren im rechtsfreien Raum ist nicht möglich – Interview mit Peggy Wöhlermann
- Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige – Frage der Woche